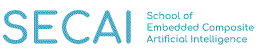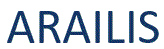Projekte
Die folgenden Projekte werden derzeit in Zusammenarbeit mit unseren akademischen und industriellen Partnern durchgeführt:
Projektbeschreibung
Vor dem Hintergrund des rasanten Fortschritts im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sind in den letzten Jahren weltweit gravierende Probleme im Zusammenhang mit Rechenleistung, IT-Infrastrukturen und vernetzten Systemen zunehmend bekannt geworden. Diese können die Weiterentwicklung von KI und darauf basierenden Zukunftstechnologien, insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Medizin und Robotik – erheblich einschränken oder im Falle von Energieversorgungsproblemen sogar zum Stillstand bringen, da KI-Anwendungen enorme Energiemengen erfordern.
Renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität Dresden (TUD), der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und der Technischen Universität München (TUM) widmen sich dieser Herausforderung nun gemeinsam im Rahmen des Pilotprojekts „GAIn“ (Next Generation AI Computing). Die Entwicklung neuer Hardware- und Softwarekonzepte für KI im GAIn-Projekt ist für unsere Arbeitsgruppe, die Abteilung für Translationale Chirurgische Onkologie (TSO), von großer Bedeutung, um den Fortschritt in der medizinischen KI- und Robotikforschung weiter voranzutreiben. Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Erhöhung der Stabilität von KI-Systemen können wir gewährleisten, dass chirurgische Assistenzsysteme präziser und effizienter arbeiten. Diese Fortschritte ermöglichen sicherere und gezieltere chirurgische Eingriffe zum unmittelbaren Nutzen der Patientinnen und Patienten.
Weitere Informationen zum GAIn-Projekt finden sich auf der Website der TU Dresden.
Eine starke Robotikindustrie wird in den kommenden Jahren die Grundlage für eine florierende Gesellschaft und Wirtschaft bilden. Das Robotics Institute Germany (RIG) soll zu einer treibenden Kraft für die deutsche Robotik werden, um Herausforderungen wie Fachkräftemangel, demografischen Wandel und Klimawandel zu begegnen.
Im Rahmen dieses Projekts konzentriert sich die TU Dresden auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer Lehrmodule sowie auf Programme zur Studierendenforschung und zur Förderung von Ausgründungen im Rahmen des Bildungsprogramms des RIG. Darüber hinaus ist die Einrichtung eines Clusters für medizinische Robotik sowie die Beteiligung an weiteren KI-basierten Robotik-Clustern innerhalb des RIG geplant. Die TU Dresden unterstützt außerdem die Umsetzung von Outreach-Konzepten zur Steigerung der Sichtbarkeit des RIG.
Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Robotik-Baukästen und interaktiven Lehrmodulen. Zudem sind Fortbildungen für Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen geplant, um das Bildungspotenzial voll auszuschöpfen. Die Förderung von Studierendenforschungsprojekten, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Industrie, sowie die Konzeption und Etablierung eines Inkubatorprogramms zur Unterstützung von Ausgründungen an der TU Dresden runden diese umfassende Initiative ab.
Zum Projekt gehört auch die Konzeption eines Clusters für medizinische Robotik gemeinsam mit Partnern innerhalb des RIG sowie die Weiterentwicklung des Testbeds für medizinische Robotik an der TU Dresden, das als Testplattform innerhalb des RIG ausgebaut werden soll.
Zu den Outreach-Aktivitäten gehören die Einbindung bestehender Initiativen wie CeTI und 6G-life, Beiträge zur visuellen Identität des RIG sowie die Bereitstellung von Best-Practice-Beispielen für effektive Kommunikation und Markenbildung.
Neural adaptive meshing for topology changes in dynamic 3D volumes

Machbarkeitsnachweis für adaptives Meshing bei Topologieänderungen unter Verwendung neuronaler Netzwerke: Im Falle eines positiven Ergebnisses hinsichtlich der Machbarkeit sollte die Methode mit Daten validiert werden, die realen Bedingungen so nahe wie möglich kommen. Der Code und die API sollten den Reifegrad eines Prototyps erreichen, um die Weiterentwicklung der Methode als Komponente für zukünftige Produkte oder zur Integration in bestehende Software zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang bezieht sich „Code“ auf den Code des neuronalen Netzwerks. Zusätzlich ist eine Visualisierung des Remeshing-Prozesses durch das Netzwerk zu Demonstrationszwecken vorgesehen. Der Code zur Integration mit der verwendeten Simulationssoftware, die Trainingsdaten und die Evaluierungsdaten werden als wertvolle Zwischenergebnisse betrachtet.
Objective Measurement of Surgical Quality through the Development of a Data-Driven Value Creation Network (SurgicalAIHubGermany)

Das Projekt „Surgical AI Hub Germany“ hat zum Ziel, die chirurgische Qualität mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu messen und zu verbessern. Durch den Aufbau einer datenorientierten Technologieplattform werden wir die Entwicklung von KI-Methoden in der Chirurgie deutlich beschleunigen und rechtliche, organisatorische sowie technologische Hürden überwinden.
Zu den Zielen gehören die Erstellung einer Demonstrationsplattform für den Umgang mit chirurgischen Daten, die Bereitstellung einer globalen Plattform für Chirurginnen und Chirurgen zur Messung und Verbesserung der chirurgischen Qualität, das Sammeln von Operationsvideos für das KI-Training, der Aufbau eines europäischen Netzwerks von Chirurginnen und Chirurgen für die KI-Forschung, die Entwicklung von Geschäftsmodellen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Etablierung von Best Practices für den Datenaustausch sowie die Erforschung neuer KI-Konzepte in der Chirurgie.
Dieses Projekt wird chirurgische Exzellenz aus renommierten Universitätskliniken, zentrale digitale Technologien deutscher Unternehmen und neueste Erkenntnisse führender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenführen. Es wird die Skalierbarkeit innovativer digitaler Geschäftsmodelle und Dienstleistungen in der Chirurgie erleichtern und letztlich die chirurgische Qualität und die Behandlungsergebnisse weltweit verbessern.
(2024 - )
The International Research Training Group (IRTG) 2251 "Immunological and Cellular Strategies in Metabolic Disease" (ICSMD)

Der transCampus ist eine einzigartige Partnerschaft, die vom King’s College London und der Technischen Universität Dresden als transnationale strategische Kooperation ins Leben gerufen wurde, basierend auf dem Prinzip echter Zusammenarbeit und einem intensiven Engagement für Kooperation in allen Bereichen.
Im Rahmen des transCampus verfolgt das IRTG 2251: ICSMD das Ziel, exzellenten Promovierenden ein spezialisiertes, aber interdisziplinäres Programm zu bieten, das eine Tandem-Betreuung durch zwei Principal Investigators sowie die Möglichkeit zum Erwerb von Zertifikaten beider Institutionen beinhaltet.
Unser Fokus liegt auf der sogenannten negativen Latenz im Kontext geteilter Autonomie bei der Fernchirurgie im Bereich metabolischer Erkrankungen. Die Vorhersage von Aufgaben und Ereignissen in der Chirurgie ist entscheidend für die Fernchirurgie, die hohe Datenraten und geringe Latenz erfordert.
Robotische Systeme und Sensoren im Operationssaal ermöglichen die Erstellung eines kompakten, datengetriebenen digitalen Zwillings der chirurgischen Situation, wodurch die Datenübertragung reduziert wird. Dieser digitale Zwilling bildet zudem die Grundlage für die Vorhersage von Ereignissen und Arbeitsabläufen mithilfe von maschinellem Lernen und damit für geteilte Autonomie, indem er Übertragungslatenzen ausgleicht und die Synchronisation mit dem realen Operationsgeschehen sicherstellt.
Um das europäische Vorhaben eines echten Kontinuums in den kommenden Jahren zu verwirklichen, verfolgt CloudSkin das Ziel, eine kognitive Cloud-Kontinuum-Plattform mit drei zentralen Innovationen aufzubauen: 1. Die CloudSkin-Plattform wird Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen (KI/ML) nutzen, um Arbeitsauslastung, Ressourcen, Energieverbrauch und Netzwerkverkehr zwischen Cloud und Edge unter sich schnell verändernden Bedingungen zu optimieren; 2. Die CloudSkin-Plattform wird Anwender zudem dabei unterstützen, eine „Stack-Identität“ über das gesamte Cloud-Edge-Kontinuum hinweg zu erreichen; 3. CloudSkin wird außerdem dazu beitragen, die notwendige Infrastruktur vorzubereiten, um neue virtualisierte Ausführungsabstraktionen in das virtuelle Ressourcenkontinuum zu integrieren – unterstützt durch die KI/ML-basierte Orchestrierungsebene der CloudSkin-Plattform.
Das Hauptziel besteht darin, eine Extreme-Near-Data-Plattform zu entwerfen, die den Zugriff, das Mining und die Verarbeitung verteilter und föderierter Daten ermöglicht, ohne dass die Nutzer die Logistik des Datenzugriffs über heterogene Datenstandorte und -pools hinweg beherrschen müssen.
Wir gehen über traditionelle, passive oder massenhaft aus Speichersystemen übernommene Daten hinaus und streben die nächste Generation von Near-Data-Processing-Plattformen sowohl in der Cloud als auch am Edge an.
In unserer Plattform umfasst „Extreme Data“ sowohl Metadaten als auch vertrauenswürdige Datenkonnektoren, die fortschrittliche Datenmanagementoperationen wie Datenentdeckung, -mining und -filterung aus heterogenen Datenquellen ermöglichen.
Die School of Embedded Composite Artificial Intelligence (SECAI) ist ein gemeinsames Projekt der TU Dresden und der Universität Leipzig zur Förderung der Künstlichen Intelligenz (KI) in Forschung und Lehre. SECAI vergibt Stipendien, stärkt die Lehre, fördert Forschende und unterstützt den internationalen Austausch.
Machine learning-based surgical guidance system for robot-assisted rectal surgery – a first-in-human interventional study (CoBot 2.0)

CoBot 2.0, das Folgeprojekt von CoBot, ist ein wegweisender Machbarkeitsnachweis und die erste interventionelle Humanstudie mit dem Ziel, die Wirksamkeit eines maschinellen Lernverfahrens zur chirurgischen Unterstützung in der roboterassistierten Rektumchirurgie zu evaluieren. Diese bahnbrechende Studie konzentriert sich darauf, chirurgische Ergebnisse durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien zu verbessern, um die Präzision bei onkologischen Rektumresektionen zu erhöhen – Eingriffe, die häufig zu Komplikationen wie sexuellen Funktionsstörungen und Inkontinenz aufgrund von Nervenschädigungen führen. Das CoBot-System soll kritische anatomische Strukturen erkennen und erhalten, um diese Risiken zu minimieren. Die Ziele des Projekts CoBot 2.0 umfassen: die Reduktion postoperativer Komplikationen durch verbesserte anatomische Erkennung während der Operation, die Bewertung und Optimierung der Nutzerfreundlichkeit KI-gestützter Systeme in der roboterassistierten Rektumchirurgie sowie das Setzen eines neuen Standards für die Integration von KI in komplexe chirurgische Verfahren – von der präklinischen bis zur klinischen Phase. Diese Studie könnte die chirurgische Praxis revolutionieren, zu besseren Behandlungsergebnissen führen und neue Maßstäbe für KI-gestützte Chirurgie setzen.
3D Navigation for Intraoperative Visualization of Tumor NAIV
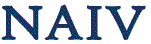
In höheren Tumorstadien des Prostatakarzinoms besteht eine Behandlungsoption in der vollständigen operativen Entfernung der Prostata. Bei diesem Eingriff gehen betroffene Männer das Risiko einer postoperativen Inkontinenz sowie Einschränkungen der Potenz ein. Um dieses Risiko zu verringern, besteht die Möglichkeit, die auf der Prostatakapsel verlaufenden verantwortlichen Nerven zu schonen. Bei dieser nervenschonenden Operation besteht jedoch das Risiko, dass Tumorreste verbleiben und die Resektion nicht im gesunden Gewebe erfolgt. Deshalb ist es entscheidend, den Tumor vollständig zu entfernen, sodass keine Tumorzellen am Schnittrand verbleiben. Intraoperative Schnellschnitte der Resektionsränder erhöhen die onkologische Sicherheit, sind jedoch häufig mit erhöhtem Blutverlust, längerer Operationsdauer und höheren Kosten verbunden.
6G-life wird die Industrie und die Start-up-Landschaft in Deutschland durch richtungsweisende Demonstrationsprojekte maßgeblich stimulieren und so die digitale Souveränität Deutschlands nachhaltig stärken. Testfelder für zwei Anwendungsszenarien sollen sowohl die Forschung vorantreiben als auch wirtschaftliche Impulse setzen. Ziel ist es, in den ersten vier Jahren mindestens zehn neue Start-ups durch 6G-life zu gründen und mindestens 30 Start-ups einzubinden. 6G-life wird zudem einen bedeutenden Beitrag zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte leisten. Darüber hinaus hat sich 6G-life zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und so einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.
virTUos knüpft an die bisherigen Erfahrungen bei der Entwicklung digital gestützter Hochschullehre an – zumeist Insellösungen ohne Verankerung in Curricula und Regularien – und entwickelt diese entlang der folgenden Handlungsleitlinien weiter: 1) Hybrides Lehren und Lernen ist eine zentrale Säule der kollaborativen Hochschulentwicklungsstrategie der TU Dresden. Diese wird in den Handlungsfeldern Praktika & Prüfungsformate, Kollaboration & Internationalisierung sowie Kompetenzentwicklung & Offene Lehre vorangetrieben. 2) Neue Lehr- und Lernszenarien werden kontinuierlich von zwei agilen Innovationsteams (Maschinenbau, Medizin, Sprachwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften) entwickelt, die sowohl didaktische als auch digitale Kompetenzen berücksichtigen. Ein Integrationsteam koordiniert Skalierung und Transfer und entwickelt die Verzahnung zentraler und dezentraler Unterstützungsstrukturen entlang der Anforderungen der Studiengangsentwicklung und der Auslegung des Prüfungsrechts im Rahmen der HYBRID-Strategie. 3) Studierende sind dabei nicht nur Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch Partnerinnen und Partner und Mitgestaltende in den genannten Teams sowie im Steuerungskreis. 4) In virTUos werden Konzepte der Offenen Lehre im Sinne von Open Educational Practices interdisziplinär entwickelt, weiterentwickelt und hochschulübergreifend eingesetzt.
Die zentrale Vision von CeTI besteht darin, Menschen die Interaktion in quasi Echtzeit mit cyber-physischen Systemen (CPS) in der realen oder virtuellen Welt über intelligente, weitreichende Kommunikationsnetze zu ermöglichen. Solche Fortschritte gehen weit über den aktuellen Stand der Technik in der Informatik und Ingenieurwissenschaft hinaus: Intelligente Kommunikationsnetzwerke und adaptive CPS für quasi-echtzeitliche Kooperationen mit dem Menschen erfordern gegenseitige Online-Lernmechanismen – eine zentrale Herausforderung. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wird CeTI einzigartige interdisziplinäre Forschung betreiben und zentrale offene Forschungsthemen in Schlüsselbereichen wie der Komplexität menschlicher Steuerung im Mensch-Maschine-Kreis, Sensor- und Aktuatortechnologien, Software- und Hardwaredesigns sowie den Kommunikationsnetzwerken als Grundlage für mehrere neuartige Anwendungsfälle in den Bereichen Medizin, Industrie und Internet der Fähigkeiten adressieren.
In den letzten drei Jahren abgeschlossene Projekte:
Projektbeschreibung
Minimalinvasive Eingriffe unter Verwendung von Endoskopen ermöglichen es, den notwendigen Nachsorgeaufwand sowie die Einschränkungen für Patientinnen und Patienten nach operativen Eingriffen zu reduzieren. Aufgrund der eingeschränkten Sicht und des fehlenden haptischen Feedbacks können diese Eingriffe für Ärztinnen und Ärzte jedoch herausfordernder sein. Ziel dieses Projekts ist es daher, Chirurginnen und Chirurgen während der Operation zu unterstützen, indem Informationen im Kamerabild eingeblendet werden.
Mehrere Erkrankungen des Mittelohres führen zu einer Schallleitungsschwerhörigkeit, z. B. chronische Otitis media, Cholesteatom und Otosklerose, welche regelmäßig durch Differenzialdiagnosen mehrerer Verfahren untersucht werden.
Die derzeitigen diagnostischen Methoden decken jedoch nur einzelne Aspekte der Pathologien ab: Die Otoskopie liefert einen visuellen Eindruck, die Tympanometrie misst die Nachgiebigkeit des Trommelfells, während die Audiometrie die allgemeine Hörleistung bewertet.
Allerdings fehlt all diesen Verfahren die Möglichkeit, die Hauptursache und den genauen Ort des Schallleitungsverlusts zu bestimmen.
Daher werden direkte otologische Diagnoseverfahren benötigt, die eine Lokalisierung und Differenzierung ermöglichen, um eine gezielte Behandlung und ein verbessertes Behandlungsergebnis für die Patientinnen und Patienten zu erreichen.
Colorectal cancer is the third most common cancer entity and the second most common cause of cancer death worldwide. Curative treatment approaches always involve surgical excision of the primary tumor and locoregional lymph nodes. About half of all colorectal cancers occur in the rectum, necessitating oncologically radical resection of the primary tumor within the mesorectal envelope. Narrow and deep pelvic anatomy and the risk of injury to adjacent anatomical structures such as ureters and pelvic nerves responsible for urogenital functions make total mesorectal excision (TME) a particularly complex surgical procedure. These challenges could potentially be overcome by an integration of smart assistance functions into robotic surgical systems.
The aim of the project "SurgOmics" is to improve decision support in hospitals before, during and after surgical procedures. During surgical treatment, a system is designed to support the decisions of the attending physicians by analyzing clinical data in real time and incorporating the latest study findings. Within the framework of SurgOmics, surgical processes are to be modeled with the help of informatic methods. In addition to the data collected during the operation, data before and after the operation will also be included.